Fotos: OberpfalzECHO/Ann-Marie Zell die ZEIT/Hamburg
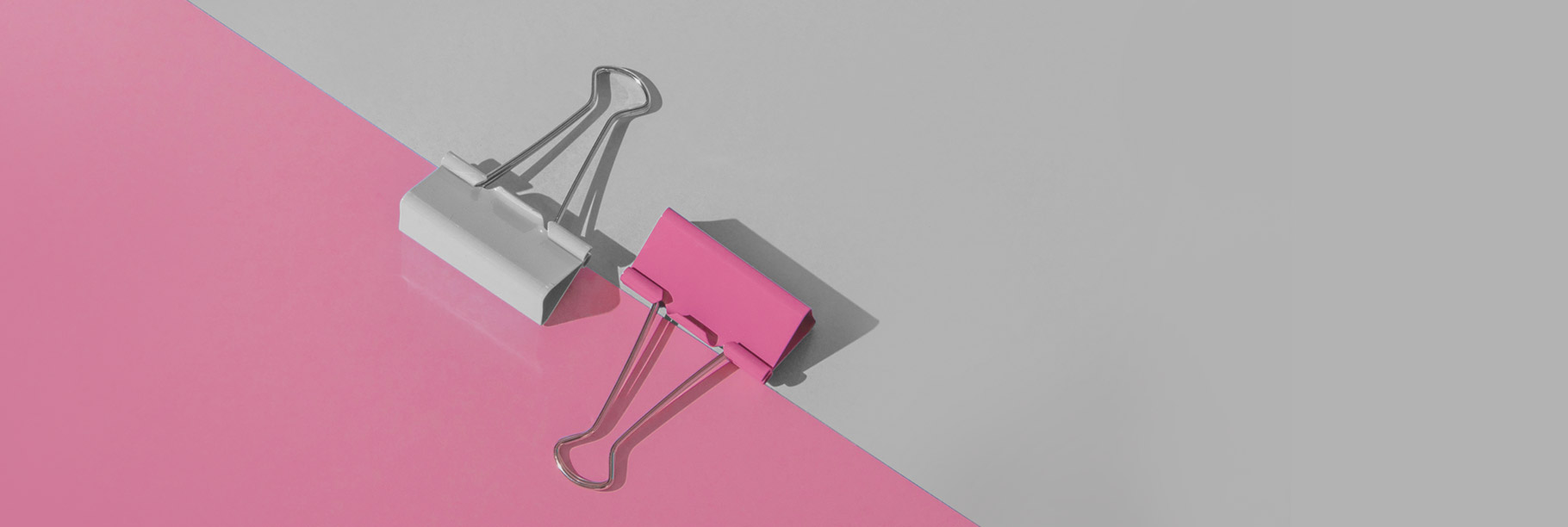
Geschichte macht stark! Artikel mit Sandra De Vito in der NZZ am Sonntag vom 22.9.2024
Wir brauchen mehr Geschichtsunterricht. Artikel mit Sandra De Vito im Tagesanzeiger vom 6.3.2025
Im Magzin der NZZ am Sonntag vom August 2020 wies der Zürcher Pädagoge Dieter Rüttimann der Schule eine Schlüsselrolle für den Bestand der Demokratie zu: «Die Schule ist der Ort, wo die Verteidigung der westlichen Demokratie gegen autoritäre Systeme beginnt.»
Wie soll Demokratie gelernt werden?
Am Ende scheint mir das die einfachste Frage. Denn wenn ein gesellschaftlicher Konsens über ihren Stellenwert besteht und auch der Berufsstand der Lehrerinnen und Lehrer sich für eine nachhaltige Einführung der kommenden Generation in die Demokratie engagiert, ergeben sich die Ziele und Inhalte von politischer Bildung fast von selbst.
Demokratieerziehung wird auf der einen Seite auf jeden Fall demokratische Praxis (1.) beinhalten, muss aber auf der anderen Seite zwingend auf weitere Bereiche fokussieren (2.-6.). In berechtigter Kritik an einer politischen Bildung, die sich auf reines Wissen beschränkte, wurden in den letzten 20 Jahren Konzepte von «Living Democracy» in den Vordergrund gestellt. Inzwischen sind diese Konzepte aber in so hohem Masse pädagogisches Allgemeingut und pädagogische Realität geworden, dass zukunftsorientierte Pädagog:innen darauf aufmerksam machen müssen, dass «Living democracy» alleine nicht genügt und ohne Wissen und Bewusstsein im schlechten Fall sogar kontraproduktiv sein kann (siehe 1.).
Ein paar wenige Andeutungen zu den Merkmalen einer nachhaltigen politischen Bildung sollen zum Weiterdenken und Diskutieren anregen:
1. «Living Democracy»
Zwar sind Schulen und Schulklassen per se keine demokratischen Gebilde. Aber sie bieten die Möglichkeit, mit Partizipation zu experimentieren, Mitsprache und Mitbestimmung in definiertem Rahmen zu leben. Unter dem Begriff «Living Democracy» sind dazu in den letzten Jahrzehnten fantastische Konzepte entwickelt worden, die in fast allen Schulen in der Schweiz in unterschiedlichen Varianten realisiert werden. Es geht darum, wie der Erziehungswissenschafter Klaus Hurrelmann in der Zeitschrift Pädagogische Führung sagt, «junge Bürgerinnen zu ermächtigen, aktiv an der Gestaltung einer demokratischen Gesellschaft teilzunehmen». Dazu braucht es die Fähigkeit, «ein eigenes Urteil über die Lebensverhältnisse zu bilden, Einfluss auf diese Verhältnisse zu nehmen, verantwortliche Rollen zu übernehmen und Meinungsverschiedenheiten respektvoll zu behandeln sowie eigene Vorstellungen mit denen anderer in Einklang zu bringen. […] Gedanken und Argumente klar und respektvoll auszudrücken», kann in allen Fächern gelernt werden. «Living Democracy» wird dann besonders wirksam, wenn es der Schule gelingt, sich «in den kommunalen Raum zu öffnen und lokale Politik am Wohnort einzubeziehen. … Kommunen sollten Räume schaffen, in denen Jugendliche ihre Anliegen, Ideen und Meinungen äussern können» (S. 10). Olaf-Axel Burow der Herausgeber der Zeitschrift Pädagogische Führung, die ihre erste Nummer im Jahr 21024 vollumfänglich der Politischen Bildung widmet, verwendet für diesen letztgenannten Aspekt den Begriff der «eingreifenden Zukunftsgestaltung»: Schule soll nicht nur mit Klassenrat und Schülerselbstverwaltung demokratisch gestaltet sein, sondern auch Möglichkeiten für gesellschaftliches Engagement in Form von Projekten in den realen Lebenswelten der Schüler:innen bieten (S. 15). Weitere Hinweise zu «Living Democracy» finden sich in der Publikation Einfach gut lernen, Kapitel «Partizipation, im Netz im Bereich Internationale Bildungsentwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich oder beim Europarat unter dem Stichwort «Living Democracy». Bedacht werden sollte dabei, dass nur echt-demokratische Partizipation ein vorbereitendes Lernen für das Leben in einer demokratischen Gesellschaft darstellt. Mitsprache und Mitbestimmung sollen nur dort stattfinden, wo sie real und rechtlich möglich sind. Unglücklich wäre, wenn an der Oberfläche Demokratie gespielt würde, die Schülerinnen und Schüler aber als verborgene Botschaft vermittelt bekämen, dass das Spiel bedeutet: Wir tun freudig «als ob» – aber wirklich bestimmen tun andere.
2. Wissen in Staatskunde
Sicher soll es in der Schule um die Auseinandersetzung über aktuelle Abstimmungen gehen, um Belange, welche die Schülerinnen und Schüler in ihrem Alltag betreffen. Aber auf keinen Fall darf sich staatskundliches Wissen darauf beschränken. Vor allem auf der Sekundarstufe I und II müssen die Grundelemente einer funktionierenden Demokratie vermittelt werden: Gewaltentrennung, Wahlen und Abstimmungen, Menschenrechte und Volkssouveränitat, Versammlungs- und Meinungsfreiheit, Vielfalt und Unabhängigkeit von Medien, Checks and Balances usw. Wer nicht versteht, wie wichtig die Grundelemente der Demokratie sind, wird auch nicht für deren Bestand einstehen können. Zudem soll die Schule eine Art Demokratiegrundregeln oder -voraussetzungen lehren: Wahlen akzeptieren, ob man gewinnt oder verliert – nicht mit Gewalt an die Macht kommen oder an der Macht bleiben – explizite und offene Distanzierung zu Gruppen, welche die vorausgehenden beiden Kriterien relativieren oder ablehnen – politische Konkurrenz als «Vitamine» für die Demokratie fördern – Recht und Möglichkeiten für Bürger:innen schaffen, sich politisch zu organisieren – Menschenrechte und Schutz von Minderheiten sichern.
3. Historisches Wissen und historisches Bewusstsein
Historisches Wissen und Bewusstsein sensibilisieren für gesellschaftliche Prozesse, helfen, über aktuelle politische Vorgänge nachzudenken und sie zu beurteilen – auch wenn Geschichte sich nie mechanisch wiederholt. Geschichtsunterricht soll sich nicht nur mit der mörderischen Vergangenheit, sondern auch mit Phasen von Prosperität, Kultur und gesellschaftlicher Harmonie und ihren Bedingungen auseinandersetzen. Historisches Bewusstsein kann in vielen Fächern, nicht allein im Geschichtsunterricht, gefördert werden, so zum Beispiel im Deutschunterricht durch Biografien, im Bereich der Naturwissenschaften durch das Erkennen der Bedeutung von wissenschaftlichem Fortschritt für die gesellschaftliche Entwicklung.
4. Kritisches Denken
Kritisches Denken kann – und muss – in jedem Fach seinen Platz haben. In Mathematik zum Beispiel durch kritisches Hinterfragen von Statistiken oder im Fach Religion und Kulturen durch Hinterfragen von Stereotypen über nicht-christliche Religionen. Immer wichtiger wird der Aspekt, den Wahrheitsgehalt von medialen Aussagen kritisch beurteilen zu können. Kritisches Denken ist der Kern eines aufgeklärten Bewusstseins – wenn es nicht entwickelt wird, bleibt alle Mühe um Demokratiebildung halbe Sache.
5. Mut
Alles Wissen nützt wenig, wenn der Mut fehlt, sich auch in schwierigen und bedrohlichen Zeiten für die Demokratie einzusetzen und sich im Notfall auch Befehlen zu widersetzen. Ich denke, dass man von einem Menschen nicht verlangen kann, dass er sich mit seinem Leben für die Sache der Demokratie einsetzt, wie das zum Beispiel die Geschwister Scholl getan haben. Aber den Mut zu finden, die eigene Meinung auch gegenüber einer erdrückenden Mehrheit zu artikulieren, ist möglich und lernbar.
6. Modelle
Lehrerinnen und Lehrer sind Modelle. Ihre Einstellung zur Demokratie, ihr Engagement für eine demokratische Gesellschaft und ihr demokratisches Handeln in der Schule und in privaten und öffentlichen Kontexten entfalten Wirkung. Wir wissen, dass Modell-Lernen für Kinder und auch für Jugendliche von grosser Bedeutung ist. Gerade deshalb wäre es wichtig, dass sich alle angehenden Lehrpersonen mit Fragen der Demokratiebildung und spezielle auch mit der Frage ihrer eignen demokratischen Praxis auseinandersetzen können.
Politische Bildung in der Schule vermag nicht alles. Nur ein gesellschaftliches Bewusstsein, nur ein breiter Konsens über die vorrangige Stellung, welche der Erhaltung und Weiterentwicklung der Demokratie für eine sichere Zukunft in Freiheit und Wohlstand zukommt, wird unser politisches System stabil halten.
Sein Buch über die Kraft der Demokratie beginnt Roger de Weck mit der Bemerkung, dass wirkliche Eliten verantwortungsvoll handeln, die Interessen des Gemeinwesens über die eigenen stellen und zu einem Denken in übergeordneten Zusammenhängen in der Lage sind. Im Gegensatz zu den Eliten sieht er das Establishment, das lediglich den Status quo verewigen will, dem es Macht, Geld, Geltung und Privilegien verdankt. Schön wäre, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler sich zu einer Elite heranbilden würden, wie sie Roger de Weck definiert.
Zu viel verlangt von der Schule? Zu dunkel die mitschwingende Befürchtung? Fragen von Mutlosen! Das folgende Plädoyer nimmt das Statement auf.
Wenn schon deutsche Fussballgrössen wie der legendäre Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, oder Uli Hoeness, Übervater des FC Bayern München, auf die Gefahr des Rechtsextremismus hinweisen, öffentlich auf Distanz zur AfD gehen und sich hörbar für die Demokratie einsetzen – dann, ja dann artikuliert sich in der Mitte einer westlichen Gesellschaft eine Sorge, eine Befürchtung, ein Unbehagen: dass nämlich die Demokratie in Gefahr ist, dass sie angegriffen wird.
Zehntausende haben in Deutschland unter Hashtags wie #WirSindDieVielen oder #HaltungZeigen demonstriert. Sie hoffen, dass die Mehrheit ein politisches System verteidigt, das auch seinen Gegnern Freiheit und Sicherheit vor Willkür garantiert.
Und in der Schweiz? Trotz Rütlischwur und langer demokratischer Tradition haben selbst wir vermutlich kein Demokratie-Gen! Auch hier bei uns geht es darum, …
… die Vielfalt der Medien, die Unabhängigkeit der Justiz, eine Balance zwischen Menschenrechten und Volkssouveränität zu verteidigen und der einfältigen Bewunderung von «starken Männern» entgegenzutreten. Natürlich geschieht das idealerweise schon in den Familien, aber die Schule spielt eine zentrale Rolle, denn nicht jede familiäre Erziehung vermag ideal auf die Demokratie vorzubereiten. Die Pädagogik ist gefragt.
Eine kurze Reise in die pädagogische Vergangenheit …
Im Jahr 1932 hat Manès Sperber – vielfach preisgekrönter Romancier und Essayist, Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels – eine Streitschrift veröffentlicht: Pädagogen am Scheideweg[1].
Darin warnt er: «Der ganze reformistische Nachkriegsfrühling mündet folgerichtig in einen neuen Sommer 1914.» Sperber, damals selbst auch Pädagoge, ruft seinen Kolleginnen und Kollegen schon fast verzweifelt zu, dass sie die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Sie würden sich auf die Reform der Pädagogik, auf die Verbesserung der erzieherischen Methoden konzentrieren und seien nicht in der Lage zu sehen, dass sich ein politisches Unheil von ungeahntem Ausmass anbahne, das am Ende all ihre Reformen zunichte machen und genau zu dem führen werde, was im Sommer 1914 geschah: zu einem neuen Weltkrieg.
Zwar sind für Sperber die Fortschritte der «Reformpädagogik» unbestreitbar. Die Schulen werden kindgerechter, die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Kindern wird herzlicher, Lernen bedeutet nicht mehr, einen Trichter zu füllen. Und das ist gut so. Aber die Aushöhlung und am Ende die Zerstörung der Demokratie, so Sperber, würden all diese Fortschritte hinfällig machen und eine Rückkehr in die pädagogische Steinzeit erzwingen. Seine pädagogischen Zeitgenossen fordert er deshalb auf, sich zu entscheiden und fortan einen Fokus auf die Erhaltung der Demokratie zu richten.
Als der Historiker Fritz Stern und der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt achtzig Jahre später, im Jahr 2010, in einem langen, veröffentlichten Gespräch auf das mörderische 20. Jahrhundert und den Nationalsozialismus zurückblicken, fragt sich Schmidt «… warum die Deutschen politisch so unaufgeklärt waren. Die politische Erziehung der grossen Masse der damals lebenden Deutschen hat in jeder Hinsicht das Prädikat unzureichend verdient. […] Das Wort Demokratie zum Beispiel habe ich in der Schule nicht ein einziges Mal gehört.»[2]
Stehen wir heute wieder an einem Scheideweg? Bräuchten wir auch heute eine klare Entscheidung für politische Bildung? Auch in der Schweiz? Oder ist hierzulande zweitrangig, dass die Welt zunehmend aus den Fugen gerät, dass Krieg, Klimakatastrophen, Terrorismus, die Zunahme autoritärer Regime und der Verlust des Glaubens an die Demokratie unsere Zukunft in Frage stellen? Unabweisbar bleibt: Die Demokratie ist nie gesichert und politische Entwicklungen beschleunigen sich bisweilen in einem atemberaubenden Tempo. Von Sperbers Warnung bis zum Ausbruch des Krieges vergingen lediglich sieben Jahre. Wenn wir uns fragen, mit welche Inhalten sich Schülerinnen und Schüler befassen müssen, damit sie die Welt von morgen mitgestalten können, sollten wir uns mit einem kardinalen Teilaspekt dieser Frage befassen: mit der Vorbereitung der kommenden Generation auf ein Leben in einer demokratischen Gesellschaft – damit alle anderen Inhalte überhaupt Sinn machen und eine Zukunft haben.
Ist die Demokratie in Gefahr?
Die Frage wird zurzeit überall diskutiert, es werden Artikel veröffentlicht, Bücher geschrieben. Eine interessante Analyse stammt vom Harvard-Politologe Daniel Ziblatt. In seinem Buch Wie Demokratien sterben[3] legt er dar, wie Demokratien sich erhalten und wie sie untergehen. Er diagnostiziert aktuell und weltweit einen Kampf zwischen Demokratien und Autokratien. Die demokratische Welt steht unter Druck, religiös-totalitäre und autoritäre Regime expandieren, und sie verbünden sich zunehmend miteinander. Die Demokratie gilt gemäss seinen Erhebungen in der Bevölkerung der westlichen Länder zwar nach wie vor als attraktivste Regierungsform – und sie scheint widerstandsfähig. Sie hat Bestand trotz Corona- oder Finanzkrise. Sie hat in den USA gelitten, aber in Polen auf demokratischen Weg antidemokratischen Tendenzen Einhalt geboten. Und nicht überraschend: Autokraten scheinen die Demokratien zu unterschätzen und nehmen Demonstrationen, Unordnung usw. nicht als das wahr, was sie sind: Phänomene, die immer zu Selbstkorrekturen des Systems beitragen und in Wahrheit Stärken sind, welche die Autokratien nicht besitzen.
Trotzdem negiert Ziblatt die Gefahren für die Demokratie nicht. Das autoritär regierte Russland und das immer totalitärer werdende China üben mit ihrer (vermeintlichen) Durchsetzungskraft auf viele Menschen eine bewundernde und gleichzeitig mit einer verborgenenen Angst aufgeladene Anziehung aus, wecken Wünsche nach dem «starken Mann». Der Vormarsch der Rechtspopulisten in Europa stellt die Werte und Institutionen der liberalen Demokratien in Frage; sie versuchen, die Justizorgane gefügig zu machen, die Opposition in Politik, Medien und Zivilgesellschaft anzugreifen, Wahlen und Wahlbezirke neu zu definieren oder Wahlresultate ganz einfach nicht zu akzeptieren. Als Beschleuniger von antidemokratischen Entwicklungen erkennt Ziblatt gesellschaftliche Ungleichheit und damit verbundene Ohnmachtsgefühle. Wirklich gefährlich wird es für ihn, wenn «Mainstream-Politiker» sich mit autoritären Parteien verbünden: «Wenn Parteien sich in ihrer Hybris Aussenseitern anschliessen, um sich an der Macht zu erhalten, geht der Schuss oft nach hinten los.»[4] Die Geschichte lehrt uns, dass autoritäre Regime auf diesem Weg legal an die Macht gelangen können.
Genau so problematisch sind ideologisch verhärtete, linke Gruppierungen, die demokratischen Regierungen die Legitimität absprechen, auf eine Revolution hinarbeiten und die Medien in ihrer Gesamtheit als Quelle von Desinformation und Manipulation durch die Mächtigen verstehen. Aber auch fundamentalistische christliche oder muslimische Gemeinschaften tragen ein antidemokratisches Potenzial in sich, das dann aktualisiert wird, wenn demokratische Regeln ihren Glaubensgesetzen widersprechen. Insgesamt können alle gesellschaftlichen Strömungen, die absolute Positionen vertreten, Kompromisse ablehnen und die Regeln von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie als ihren Überzeugungen nachgeordnet betrachten, für den Bestand der Demokratie gefährlich werden. Dies gilt nicht zuletzt bis zu einem gewissen Grad auch für die aktuell prosperierende Identitätspolitik, bei der oft nicht demokratische Einstellungen, Staatsraison, nationales Interesse und diskursive Ethik zählen, sondern allein eine eigene, absolutistisch gesetzte Partial-Moral.
Die Infragestellungen von Demokratie nehmen zu[5] – und gleichzeitig verliert die politische Bildung, wie weiter unten gezeigt wird, an Terrain. Deshalb glaube ich: Pädagoginnen und Pädagogen können sich aus der «Demokratiefrage» nicht heraushalten. Eine klare Analyse der Welt ohne Denkbarrieren ist für den Berufsstand, für jede Pädagogin, jeden Pädagogen unverzichtbar – ebenso ein evidenzbasiertes Bild über politisches Wissen und Bewusstsein der Jugend. Nur so können Notwendigkeit und Eckpunkte einer politischen Bildung mit-definiert und nicht allein der Politik überlassen werden. Wer wollte Emmanuel Macron widersprechen: «Ich möchte nicht zu einer Generation der Schlafwandler gehören. Ich möchte zu einer Generation gehören, die standhaft entschieden hat, ihre Demokratie zu verteidigen!»
Eine unpolitische Jugend?
Wird die Jugend hedonistischer? Ist sie immer weniger an Politik interessiert? Oder engagieren sich junge Menschen im Gegenteil vermehrt und gehen lediglich auf Distanz zum bekannten Politikbetrieb? Die Rede von der unpolitischen Jugend ist verbreitet. Wer jedoch einen vorschnellen Positionsbezug vermeidet und die Befunde zur Frage studiert, erkennt, dass sie widersprüchlich und unklar sind.
Für die Schweiz wird oft auf die IAE Studien[6] über politisches Wissen und politische Einstellungen der Jugend in etwa drei Dutzend Ländern Bezug genommen. Während in der ersten Studie (1999) das politische Wissen und Verstehen der Schweizer Jugendlichen am unteren Ende der Skala lag, rangierte die Schweiz zehn Jahre später im oberen Mittelfeld. Kürzlich relativierte Béatrice Ziegler, Co-Direktorin des Zentrums für Demokratie Aarau, das bessere Abschneiden jedoch, weil es vor allem durch eine andere Zusammensetzung der beteiligten Länder bedingt war.[7] Zudem waren die Fragen in der Studie nicht auf das Schweizer System der direkten Demokratie ausgerichtet. Auch weitere Resultate waren widersprüchlich: Zwar schien das Interesse der Jugendlichen an Politik gering und der Glaube, politisch etwas bewirken zu können, minim, das Vertrauen in die staatlichen Institutionen jedoch hoch.
Gemäss dem neuesten Forschungsbericht der Eidgenössischen Kommission für Kinder- und Jugendfragen[8] verstehen Jugendliche sich selbst kaum als politisch aktiv, weil sie unter politischer Partizipation vor allem an konventionelle Formen wie Abstimmungen und Wahlen denken. Werden Aktivitäten auf Social Media einbezogen, ergibt sich ein anderes Bild und Jugendliche erscheinen deutlich politischer. Es zeigte sich zudem, dass die Motivation zu politischer Partizipation direkt mit einem Grundverständnis von Strukturen und Prozessen der Politik, also mit politischer Bildung zusammenhängt. Ohne diese fühlen sich Jugendliche von politischen Fragen überfordert. Und nicht erstaunlich: Wer politisch besser gebildet ist, ist eher interessiert, informiert sich häufiger, was wiederum das politische Verständnis und Interesse stärkt – ein zirkulärer Prozess in beide Richtungen. Die Studie vermutet, dass ein «verbesserter Zugang zu politischer Bildung unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund» und «ein vereinfachter Zugang zu Angeboten konventioneller/institutioneller Politik» das politische Interesse der Jugend steigern würde.[9]
Dass sich Jugendliche weniger im Rahmen traditioneller Institutionen wie Parteien oder Gewerkschaften, sondern spontan, punktuell, problembezogen, situativ und mit geringer Einbindung in Strukturen engagieren, zum Beispiel in der Bewegung Fridays for Future, wird schon seit Jahrzehnten beobachtet und nicht nur negativ kommentiert. So schrieb Ulrich Beck in Kinder der Freiheit schon vor Jahren, die neuen Generationen setzten auf «Spontaneität und Freiwilligkeit des politischen Engagements, Selbstorganisation, Abwehr von Formalismen und Hierarchie, Widerborstigkeit, Kurzfristigkeit» und darauf, «sich nur dort einzusetzen, wo man Subjekt des Handelns bleibt».[10] Die darin sich manifestierende Individualisierung stelle vor der Weltgeschichte mit Diktaturen, in denen das Motto «du bist nichts, dein Volk, deine Klasse ist alles» eine deutliche Errungenschaft dar.[11]
Mit den Social Media erhält die von Beck angesprochene Individualisierung allerdings eine neue Dimension. Jugendliche nutzen sie als News-Lieferanten und entkoppeln sich dadurch nicht nur von realen Beziehungen, sondern auch von einem gesamtgesellschaftlich geteilten Verständnis von Welt. Was es bedeutet, dass sie sich stärker über soziale Netzwerke als über klassische Medien informieren, lässt sich noch nicht abschliessend beurteilen. Dass sie aber scheinbar zufälligen Informationsquellen vertrauen und Influencern folgen, schliesst undurchschaubare Manipulationsversuche nicht aus und muss für die politische Bildung in Betracht gezogen werden.
Einen knapp gehaltenen, aber umfassenden Überblick über die Forschungslage zur politischen Einstellung junger Menschen und zur politischen Bildung stellt Simone Abendschön, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Giessen, in Politische Bildung und politische Bildungsforschung[12] zusammen. Zwei Befunde stechen dabei heraus und scheinen mir für jegliches Konzept von Demokratiebildung fundamental:
1. Die Entwicklungspsychologie zeigt immer klarer, dass Kinder schon sehr früh, wie in anderen Domänen, auch im Bereich von Gesellschaft und Politik sogenannte «naive Theorien» entwickeln und mit ihrer Hilfe neue Informationen in einen früh entstehenden Wissensspeicher integrieren. Schon bei Schuleintritt – und nicht erst im Alter von etwa zwölf Jahren, wie man längere Zeit mit Bezug zu Piaget geglaubt hat – kennen sie politische Themen und bauen Werte und Orientierungen auf. Mangelhafte Orientierungen wiederum hängen nicht mit dem Alter, sondern mit fehlendem Input und geringer Anregung zusammen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass «Misskonzepte» durch schulischen Unterricht modifiziert und elaboriertere Verstehensformen gefördert werden können.
2. Abendschön kommt zum Schluss, dass «die ’üblichen Verdächtigen’ sowohl der Bildungs- als auch der Partizipationsforschung, nämlich ein Migrationshintergrund sowie das Aufwachsen in einer Familie mit niedrigem sozioökonomischem Status, Grundschulkinder bei ihrer Entwicklung zentraler politischer Orientierungen benachteiligen».[13] Geringes kulturelles Kapital wirkt in die gleiche Richtung. Bestätigt werden die Befunde vom erwähnten Bericht der Eidgenossenschaft. Zwar wurden dort keine Zahlen erhoben, aber es wird festgehalten, dass unter anderem Nationalität und sozio-ökonomischer Status sich auf Interesse und Partizipation auswirken. Insgesamt sind besser gebildete Jugendliche auch politisch besser gebildet, interessierter, partizipativer.[14] Und Beatrice Ziegler ergänzt, dass in der Schweiz die schwächsten 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler über ein krass geringes politisches Wissen verfügen.[15]
Politische Bildung soll vor dem Hintergrund dieser Befunde einerseits schon in der Grundschule einsetzen, und sie muss andererseits besonders auf die Förderung der schwächeren Schülerinnen und Schüler und auf ihren kulturellen Background achten.
Was wissen wir über die Wirkung von Demokratiebildung?
Es wird breit geforscht. Politische Sozialisations- und Einstellungsforschung gibt es seit den 1960er Jahren, zuerst in den USA, Politikwissenschaft, Soziologie, Erziehungswissenschaft, Psychologie und Politik- und Geschichtsdidaktik sind die wichtigsten beteiligten Disziplinen. Systematische empirische Untersuchungen im Bereich politischer Bildung gibt es seit den 1990er Jahren, umfassendere quantitative Untersuchungen seit knapp zwei Jahrzehnten.
Trotz zahlloser Erhebungen, trotz vieler Detailstudien, trotz politikdidaktischer Modelle zum Thema erfolgreicher politischer Bildung in der Schule bleibt die Frage nach ihrer Wirksamkeit schwer zu beantworten. Man weiss, dass durch Schulunterricht politische Kenntnisse aufgebaut werden können, aber gleichzeitig ist unbestreitbar, dass allein durch richtige Information die kommenden Generationen nicht unbedingt demokratietauglich und -erhaltend sein werden. Es geht eben nicht «nur um Wissen und Kenntnisse», sondern mindestens so sehr um «die Unterstützung demokratischer Werte und Normen, denn wer über gutes politisches Wissen verfügt, muss [noch] kein guter Demokrat sein».[16]
Interventionsstudien, welche einen längeren Zeitraum ins Auge fassen und die Langzeiteffekte von politischer Bildung beurteilen könnten, fehlen weitgehend. Es ist zudem schwierig, sie so zu konzipieren, dass nicht nur einzelne Aspekte ausgelotet werden, sondern auch ganz generelle Faktoren wie die Position von Parteien, Gewerkschaften, Berufsverbänden und Kirchen zur Demokratie und zur politischen Bildung sowie die in der Gesellschaft bewusst oder latent vorhandene Einstellung in den Blick geraten. Aber genau diese Parameter sind wahrscheinlich in hohem Mass für den Erfolg politischer Bildung relevant – auch wenn sie empirisch schwer zu kontrollieren sind.
Ein Verlust von gesellschaftlicher Erinnerungsfähigkeit?
Der Sozialphilosoph und Soziologe Oskar Negt – lohnenswert hineinzuhören in: «Demokratie muss gelernt werden» (https://www.youtube.com/watch?v=XX7bOEX3arM): Wiener Stadtgespräch mit Oskar Negt auf Youtube – weist im Zusammenhang von Demokratiebildung auf ein weiteres, für ihn beunruhigendes und bedrohliches Phänomen hin: Nicht nur in der Pädagogik, sondern ganz generell, vollzieht sich gemäss seiner Analyse im Verhältnis zur Geschichte ein kultureller Rückbildungsprozess.[17] Wir sind, so Negt, ganz grundsätzlich mit einem Verlust der gesellschaftlichen Erinnerungsfähigkeit und auch mit einem Sinken im Reflexionsniveau geschichtlicher Prozesse konfrontiert. Lebendige Kultur aber ist nur existenzfähig, wenn die Menschen mit ihrem kollektiven Gedächtnis pfleglich umgehen. Ohne die Idee politischer Urteilsfähigkeit und echten geschichtlichen Lernens führt dagegen jede Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu sinnlosen, ja fatalen Resultaten: zu arroganter Distanzierung oder bewusstloser Identifikation.
Mit dem postulierten Verlust an historischem Denken und dem Mangel an historischer Bildung korrespondiert die reale Defensive, in die sich der Geschichts- und Staatskundeunterricht in der Schweiz seit Jahrzehnten gedrängt sehen. Sowohl in der Volksschule als auch in den Gymnasien und Berufsschulen haben beide einen schweren Stand. In der Volksschule geht die Disziplinarität von Geschichte in ein diffuses Konzept von «Räume, Zeiten, Gesellschaften» auf. An den Gymnasien wurde der Staatskundeunterricht abgeschafft und der Geschichtsunterricht durch die Maturitätsreform von 1995 reduziert. An den Berufsschulen ist die Stellung der Allgemeinbildung, bedingt durch den historischen Entstehungszusammenhang aus der Privatwirtschaft, seit jeher prekär. Mit Blick auf die Lehrpläne kann zwar nicht von einer «stiefmütterlichen Rolle der politischen Bildung»[18] gesprochen werden. Ein Expertenbericht des Staatssekretariats für Bildung hält jedoch fest, dass die Lehrpläne nur bedingt die Basis für die Realität des Unterrichts darstellen, dass, im Gegensatz zum Unterricht in ICT, keine nationalen Strategien existieren, die Lehrpläne von Schule zu Schule unterschiedliches Gewicht auf politische Bildung legen und dass letztlich ein «beschränkter politischer Wille zur Stärkung der politischen Bildung bestehe»[19]. Schliesslich gibt es auch den Pädagogischen Hochschulen kein Konzept für die politische Bildung aller angehenden Volks- und Berufsschullehrer:innen.
Wie soll Demokratie gelernt werden?
Am Ende scheint mir das die einfachste Frage. Denn wenn ein gesellschaftlicher Konsens über ihren Stellenwert besteht und auch der Berufsstand der Lehrerinnen und Lehrer sich für eine nachhaltige Einführung der kommenden Generation in die Demokratie engagiert, ergeben sich die Ziele und Inhalte von politischer Bildung fast von selbst.
Demokratieerziehung wird auf der einen Seite auf jeden Fall demokratische Praxis (1.) beinhalten, muss aber auf der anderen Seite zwingend auf weitere Bereiche fokussieren (2.-6.). In berechtigter Kritik an einer politischen Bildung, die sich auf reines Wissen beschränkte, wurden in den letzten 20 Jahren Konzepte von «Living Democracy» in den Vordergrund gestellt. Inzwischen sind diese Konzepte aber in so hohem Masse pädagogisches Allgemeingut und pädagogische Realität geworden, dass zukunftsorientierte Pädagog:innen darauf aufmerksam machen müssen, dass «Living democracy» alleine nicht genügt und ohne Wissen und Bewusstsein im schlechten Fall sogar kontraproduktiv sein kann (siehe 1.).
Ein paar wenige Andeutungen zu den Merkmalen einer nachhaltigen politischen Bildung sollen zum Weiterdenken und Diskutieren anregen:
1. «Living Democracy»
Zwar sind Schulen und Schulklassen per se keine demokratischen Gebilde. Aber sie bieten die Möglichkeit, mit Partizipation zu experimentieren, Mitsprache und Mitbestimmung in definiertem Rahmen zu leben. Unter dem Begriff «Living Democracy» sind dazu in den letzten Jahrzehnten fantastische Konzepte entwickelt worden, die in fast allen Schulen in der Schweiz in unterschiedlichen Varianten realisiert werden. Es geht darum, wie der Erziehungswissenschafter Klaus Hurrelmann in der Zeitschrift Pädagogische Führung sagt, «junge Bürgerinnen zu ermächtigen, aktiv an der Gestaltung einer demokratischen Gesellschaft teilzunehmen». Dazu braucht es die Fähigkeit, «ein eigenes Urteil über die Lebensverhältnisse zu bilden, Einfluss auf diese Verhältnisse zu nehmen, verantwortliche Rollen zu übernehmen und Meinungsverschiedenheiten respektvoll zu behandeln sowie eigene Vorstellungen mit denen anderer in Einklang zu bringen. […] Gedanken und Argumente klar und respektvoll auszudrücken», kann in allen Fächern gelernt werden. «Living Democracy» wird dann besonders wirksam, wenn es der Schule gelingt, sich «in den kommunalen Raum zu öffnen und lokale Politik am Wohnort einzubeziehen. … Kommunen sollten Räume schaffen, in denen Jugendliche ihre Anliegen, Ideen und Meinungen äussern können» (S. 10). Olaf-Axel Burow der Herausgeber der Zeitschrift Pädagogische Führung, die ihre erste Nummer im Jahr 2024 vollumfänglich der Politischen Bildung widmet, verwendet für diesen letztgenannten Aspekt den Begriff der «eingreifenden Zukunftsgestaltung»: Schule soll nicht nur mit Klassenrat und Schülerselbstverwaltung demokratisch gestaltet sein, sondern auch Möglichkeiten für gesellschaftliches Engagement in Form von Projekten in den realen Lebenswelten der Schüler:innen bieten (S. 15). Weitere Hinweise zu «Living Democracy» finden sich in der Publikation Einfach gut lernen, Kapitel «Partizipation»[20], im Netz im Bereich Internationale Bildungsentwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich[21] oder beim Europarat[22] unter dem Stichwort «Living Democracy». Bedacht werden sollte dabei, dass nur echt-demokratische Partizipation ein vorbereitendes Lernen für das Leben in einer demokratischen Gesellschaft darstellt. Mitsprache und Mitbestimmung sollen nur dort stattfinden, wo sie real und rechtlich möglich sind. Unglücklich wäre, wenn an der Oberfläche Demokratie gespielt würde, die Schülerinnen und Schüler aber als verborgene Botschaft vermittelt bekämen, dass das Spiel bedeutet: Wir tun freudig «als ob» – aber wirklich bestimmen tun andere.
2. Wissen in Staatskunde
Sicher soll es in der Schule um die Auseinandersetzung über aktuelle Abstimmungen gehen, um Belange, welche die Schülerinnen und Schüler in ihrem Alltag betreffen. Aber auf keinen Fall darf sich staatskundliches Wissen darauf beschränken. Vor allem auf der Sekundarstufe I und II müssen die Grundelemente einer funktionierenden Demokratie vermittelt werden: Gewaltentrennung, Wahlen und Abstimmungen, Menschenrechte und Volkssouveränitat, Versammlungs- und Meinungsfreiheit, Vielfalt und Unabhängigkeit von Medien, Checks and Balances usw. Wer nicht versteht, wie wichtig die Grundelemente der Demokratie sind, wird auch nicht für deren Bestand einstehen können. Zudem soll die Schule eine Art Demokratiegrundregeln oder -voraussetzungen lehren: Wahlen akzeptieren, ob man gewinnt oder verliert – nicht mit Gewalt an die Macht kommen oder an der Macht bleiben – explizite und offene Distanzierung zu Gruppen, welche die vorausgehenden beiden Kriterien relativieren oder ablehnen – politische Konkurrenz als «Vitamine» für die Demokratie fördern – Recht und Möglichkeiten für Bürger:innen schaffen, sich politisch zu organisieren – Menschenrechte und Schutz von Minderheiten sichern.
3. Historisches Wissen und historisches Bewusstsein
Historisches Wissen und Bewusstsein sensibilisieren für gesellschaftliche Prozesse, helfen, über aktuelle politische Vorgänge nachzudenken und sie zu beurteilen – auch wenn Geschichte sich nie mechanisch wiederholt. Geschichtsunterricht soll sich nicht nur mit der mörderischen Vergangenheit, sondern auch mit Phasen von Prosperität, Kultur und gesellschaftlicher Harmonie und ihren Bedingungen auseinandersetzen. Historisches Bewusstsein kann in vielen Fächern, nicht allein im Geschichtsunterricht, gefördert werden, so zum Beispiel im Deutschunterricht durch Biografien, im Bereich der Naturwissenschaften durch das Erkennen der Bedeutung von wissenschaftlichem Fortschritt für die gesellschaftliche Entwicklung.
4. Kritisches Denken
Kritisches Denken kann – und muss – in jedem Fach seinen Platz haben. In Mathematik zum Beispiel durch kritisches Hinterfragen von Statistiken oder im Fach Religion und Kulturen durch Hinterfragen von Stereotypen über nicht-christliche Religionen. Immer wichtiger wird der Aspekt, den Wahrheitsgehalt von medialen Aussagen kritisch beurteilen zu können. Kritisches Denken ist der Kern eines aufgeklärten Bewusstseins – wenn es nicht entwickelt wird, bleibt alle Mühe um Demokratiebildung halbe Sache.
5. Mut
Alles Wissen nützt wenig, wenn der Mut fehlt, sich auch in schwierigen und bedrohlichen Zeiten für die Demokratie einzusetzen und sich im Notfall auch Befehlen zu widersetzen. Ich denke, dass man von einem Menschen nicht verlangen kann, dass er sich mit seinem Leben für die Sache der Demokratie einsetzt, wie das zum Beispiel die Geschwister Scholl getan haben. Aber den Mut zu finden, die eigene Meinung auch gegenüber einer erdrückenden Mehrheit zu artikulieren, ist möglich und lernbar.
6. Modelle
Lehrerinnen und Lehrer sind Modelle. Ihre Einstellung zur Demokratie, ihr Engagement für eine demokratische Gesellschaft und ihr demokratisches Handeln in der Schule und in privaten und öffentlichen Kontexten entfalten Wirkung. Wir wissen, dass Modell-Lernen für Kinder und auch für Jugendliche von grosser Bedeutung ist. Gerade deshalb wäre es wichtig, dass sich alle angehenden Lehrpersonen mit Fragen der Demokratiebildung und spezielle auch mit der Frage ihrer eignen demokratischen Praxis auseinandersetzen können.
Politische Bildung in der Schule vermag nicht alles. Nur ein gesellschaftliches Bewusstsein, nur ein breiter Konsens über die vorrangige Stellung, welche der Erhaltung und Weiterentwicklung der Demokratie für eine sichere Zukunft in Freiheit und Wohlstand zukommt, wird unser politisches System stabil halten.
Sein Buch über die Kraft der Demokratie[23] beginnt Roger de Weck mit der Bemerkung, dass wirkliche Eliten verantwortungsvoll handeln, die Interessen des Gemeinwesens über die eigenen stellen und zu einem Denken in übergeordneten Zusammenhängen in der Lage sind. Im Gegensatz zu den Eliten sieht er das Establishment, das lediglich den Status quo verewigen will, dem es Macht, Geld, Geltung und Privilegien verdankt. Schön wäre, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler sich zu einer Elite heranbilden würden, wie sie Roger de Weck definiert.
28. Dezember 2024